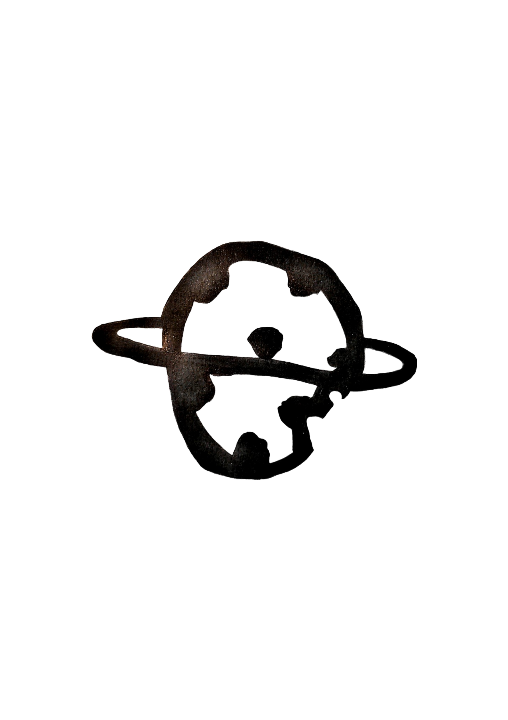Der Versuch einer Antwort auf die Frage, ob man über etwas schreiben darf, das man nicht kennt.
In der Welt da draußen gibt es unzählige Regeln und Schreibtipps, die uns das Schreiben erleichtern sollen – doch manchmal machen sie uns das Leben unnötig schwer. Neulich habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ob man über Dinge schreiben darf, die man nicht selbst erlebt hat. Wenn du wissen willst, warum das Schreiben über Unbekanntes sogar positiv ist und wie du dabei vorgehen kannst, lies hier weiter.
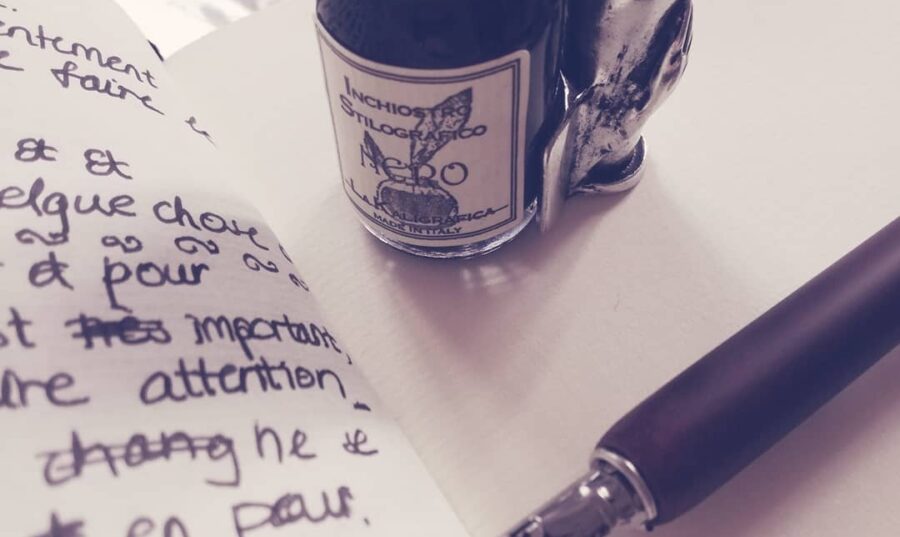
„Schreibe nur über das, was du kennst“ – dieser Tipp schwebt mir immer wieder im Kopf herum, wenn ich blockiert vor meinem Computer sitze. Es ist einer dieser kühnen Sätze, den ich mal in einem Kurs über Kreatives Schreiben aufgeschnappt habe. Man solle sich beim Schreiben vor allem auf etwas berufen, das man selbst erlebt hat – das erleichtere nicht nur den Schreibprozess, sondern verringere auch das Risiko, etwas falsch zu machen. Verheerende Fehler lauern nämlich überall dort, wo der Autor über etwas schreibt, das er nicht kennt. Wie ein vielköpfiges Monster bäumen sie sich hinter dem Schreibenden auf und machen ihm Vorwürfe: „Dein Text ist unauthentisch, viel zu oberflächlich, ja nahezu dumm!“ Zusammen mit der Leserschaft lacht das Monster den Autor aus wie Bowser einen geschwächten Mario. Denn sie alle merken es doch, wenn der Autor nicht weiß, was er tut.
Ich möchte dem vielköpfigen, dämonisch lachenden Monster etwas entgegensetzen. In der Welt da draußen gibt es unzählige Regeln und Tipps, die uns das Schreiben erleichtern sollen, doch manchmal machen sie uns das Leben unnötig schwer. Der Gedanke, dass ich über etwas nicht schreiben darf, bloß weil ich es selbst nicht erlebt habe, blockiert mich. Weder kann ich sämtliche Gefühle und Erlebnisse dieser Welt selbst erfahren, noch ist es sinnvoll, ausschließlich autobiographisch zu schreiben. Ich finde es gerade spannend, mich über das Schreiben in andere Menschen und Lebenswelten hineinzuversetzen. Und wenn ich mir das verbieten muss, dann verbiete ich mir zugleich den Spaß am Schreiben. Hier also mein Plädoyer dafür, dass man sehr wohl über etwas schreiben darf, das man nicht kennt.
![]()
Noch bevor ich eingeschult worden bin, lernte ich, meinen Namen zu schreiben. Meistens signierte ich die ersten Wasserfarb-Kunstwerke mit „SonjA“. Es war meine erste buchstäbliche Errungenschaft, meine geschriebene Signatur. In der Grundschule formulierte ich dann kleine Texte darüber, was ich in den Sommerferien erlebt habe. Und als ich das erste Mal verknallt war, entdeckte ich das Tagebuchschreiben für mich. So oder so ähnlich kommen wohl die meisten Menschen zum Schreiben – indem sie festhalten, was sie täglich beschäftigt, wie sie die Welt wahrnehmen und was sie erleben. Kurz: indem sie beim Schreiben sich selbst begegnen.
Ich kann also nicht bestreiten, dass ich beim Schreiben in erster Linie persönliche Erlebnisse verarbeite, egal ob in Form von Tagebüchern oder fiktiven Romanen. Jedes Buch enthält einen Teil des Autors, der sich in den kleinen Dialogfetzen, aufmerksamen Beschreibungen oder großen Gefühlen verstecken kann.
Doch mein Leben dreht sich nicht nur um mich selbst. Und irgendwann wird es langweilig, mich immerzu mit meinem eigenen Leben zu beschäftigen – ich bin ja sowieso mittendrin. Es ist viel spannender, mir ein Leben auszudenken, das über die Grenzen meiner eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Als junges Mädchen bin ich meiner ersten großen Liebe auf dem Papier begegnet oder konnte mithilfe meiner Vorstellungskraft über die Baumkronen hinwegfliegen. Indem ich Geschichten schreibe, kann ich neue Welten erkunden und mich in Menschen oder Geschöpfe hineinversetzen, die vielleicht ganz anders sind als ich. Vielleicht gebe ich meinen Figuren Eigenschaften, die ich selbst gern hätte, so wie Deniz Gamze Ergüven in Mustang und Astrid Lindgren in Pippi Langstrumpf. Was immer ein Autor im Sinn hat – das Schreiben gibt ihm die Möglichkeit, etwas zu erleben, das er sonst nicht erleben könnte, egal ob es sich um Gefühle, Lebenserfahrungen oder Charaktereigenschaften handelt. Wieso sollte ich mir das verbieten?
„Nun ja“, könnte die Antwort lauten, „weil du dann Gefahr läufst, dich zu verzetteln. Vor allem wenn du über Themen schreibst, die schwer zugänglich sind – wie etwa das Leben in anderen Ländern, religiösen Gruppen oder Subkulturen – ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dir dumme Fehler passieren. Vielleicht beschreibst du das Land zu oberflächlich, weil du eben nicht die feinen Unterschiede und Hintergründe kennst. Du romantisierst die Vorstellung, die du vom Thema hast, weil du bestenfalls einen Touri-Urlaub oder eine Google-Reise unternommen hast. Im schlimmsten Fall könntest du jemanden mit deinem Text verletzen, weil du total überheblich bist oder alles ganz falsch darstellst. Und wie wird sich das wohl anfühlen, für all diese dummen Fehler dann noch ausgelacht und kritisiert zu werden?“
Und schon habe ich wieder Angst vor diesem vielköpfigen Monster, das ja gar nicht mal so falsch liegt. Natürlich fürchte ich mich davor, kritisiert und ausgelacht zu werden, andere zu verletzen oder wütend zu machen. Aber kann ich mich wirklich schon vor dem Schreiben mit all dieser Kritik auseinandersetzen? Sollte ich mir nicht erlauben, es wenigstens zu versuchen? Egal, wie umfassend ich ein Thema bearbeiten möchte: die Gefahr, einen Fehler zu machen, lauert überall. Ließe ich mich allerdings immer schon vorher von einem Vorhaben abbringen, dann würde ich niemals etwas zustande bekommen. Dann hätte ich nicht einmal gelernt, meinen Namen zu schreiben. Also plädiere ich dafür, Fehler zu machen und sie anschließend zu beheben. Wie schaffe ich es also, über etwas zu schreiben, das ich nicht kenne? Und zwar ohne in die Falle des Monsters zu tappen und mich komplett zu blockieren?
Zunächst mal kommt man um das Thema Recherche nicht herum. Alles, was über die eigenen Lebenserfahrungen hinausgeht, erfordert zwangsläufig Recherche, sogar wenn der Roman nur in einem anderen Teil von Deutschland spielt. Wenn ich über ein Thema schreiben möchte, das mir weitestgehend fremd ist, beginne ich schon vor dem Schreiben mit der Recherche.
Ich tauche so tief wie möglich in diese fremde Welt ein. Dafür verschaffe ich mir zunächst einen groben Überblick und durchsuche das gesamte Internet, denn heutzutage gibt es ja über alles genaue Informationen, man muss nur danach suchen, muss sie nur finden. Bevor ich ins Detail gehen kann, will ich zuerst das Wesentliche verstehen. Danach plane ich kleine Reisen, durch die ich besonders viele Erfahrungen zum Ort des Geschehens sammeln kann, ich sauge Informationen und Bilder in mir auf und werde selbst Teil des Themas. Allmählich kann ich mich immer besser in die Menschen einfühlen, die anders leben als ich. Wenn ich Fragen stelle, erhalte ich Antworten.
Wer wirklich recherchiert, der widmet sich voll und ganz dem Thema – und das braucht Zeit. Irgendwann verschwimmt dann alles miteinander. Nachts, wenn ich schlafe, träume ich davon. Morgens, wenn ich aufwache, spüre ich etwas, das auch mein Protagonist empfinden könnte. Es ist wie ein Puzzle, bei dem allmählich ein immer umfassenderes Bild entsteht. Und aus der anfänglichen Faszination und Romantisierung entsteht etwas realitätsnahes, neue Gefühle kommen auf, vielleicht sogar Wut auf das Thema und alle Beteiligten, Wut darauf, dass es doch nicht so leicht zugänglich ist. Vielleicht ist jeder Schreib- und Rechercheprozess wie eine Liebesbeziehung, die mit dem Kennenlernen und seinen kribbelnden, vorfreudigen Gefühlen beginnt, bis dann die ersten Hüllen fallen und man die Schattenseiten kennenlernt.
Ich glaube der Unterschied zwischen Authentizität und Oberflächlichkeit liegt in der Art und Weise, wie intensiv man sich dem Thema widmet. Eine gründliche Recherche kann sich über Jahre ziehen, weil es immer wieder neue Facetten zu entdecken gibt. Weil das Thema von der Fantasie in die Realität muss und von der Realität wieder zurück in die Fantasie und dann noch aufs Papier. Aber das ist trotz allem ein schöner, faszinierender Prozess. Und während ich das Thema vorher nicht wirklich kannte, habe ich es in dieser Zeit endlich kennen gelernt. Tatsache ist also, dass mich das Schreiben dazu bringt, etwas dazuzulernen, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Fakten, sondern auch auf der Gefühlsebene, hinein ins Menschliche, ins individuelle Erleben. Das erfordert nicht nur Empathie, sondern auch die Offenheit dafür, dass es eben doch ganz anders ist, als ich dachte.
Wer das romantisch findet, wird am schnellsten erwischt.
– Larissa Kikol
Die meisten Schriftsteller verfügen wohl über ein gewisses Maß an Empathie oder zumindest über eine Feinfühligkeit für Situationen und Augenblicke. Dadurch können sie sich – mit dem nötigen Hintergrundwissen im Kopf – gleichermaßen in einen Serienkiller wie in einen Baum hineinversetzen, ohne eines von beidem selbst zu sein. Die Kunst liegt darin, die richtigen Fragen zu stellen und der Intuition zu folgen. In Julia Camerons Schreibratgeber Von der Kunst des kreativen Schreibens heißt es: „Ich bin davon überzeugt, dass wir als Schriftsteller häufig Zugang zu Informationen haben, die sich jenseits unserer normalen Reichweite befinden. Wir fragen: ‚Wie würde sich diese Figur verhalten?‘, und die Antwort, die wir hören, basiert oft auf einem derartigen Detailreichtum und einem so hohen Niveau an Richtigkeit, dass sie der Prüfung der Zeit standhält.“
Ein tolles Beispiel für dieses Phänomen ist der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, der mit seinen raffinierten Gemälden sogar die größten Kunstexperten hinters Licht führen konnte. Für seine Fälschungen wählte Beltracchi verschollene Originale bekannter Maler oder erfand neue Motive, die sich in das Gesamtwerk eines Künstlers einreihen ließen. Dass Beltracchi jedes Bild im Geist des jeweiligen Künstlers malte und dessen künstlerische Handschrift für neue Arbeiten nutzte, zeugt neben seinen handwerklichen Fähigkeiten vor allem von einem sehr hohen Level an Empathie und Intuition. Und damit hat er in etlichen Fällen ins Schwarze getroffen.
Wenn ich mich in ein Thema einfühle, muss ich mich also nicht auf die Realität beschränken. So wie Beltracchi ein ganz neues Gemälde im Geiste des Originals erschaffen kann, darf auch ich meine Vorstellungskraft nutzen, um mich in ein Thema einzufühlen und intuitiv über etwas zu schreiben. Und mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es der Realität unerwartet nahe. Natürlich ist Authentizität wichtig, und auch Beltracchi war ein großer Kunstexperte, als er die Bilder malte. Dennoch habe ich die kreative Freiheit, meine eigene Geschichte zu erzählen. Es ist also nicht notwendig, mich auf eine genaue Wiedergabe der Realität zu beschränken – stattdessen kann ich Elemente meiner Recherche in meine eigene kreative Handlung einfließen lassen und den Schreibprozess genießen.
Ein Künstler, denke ich, ist doch nichts anderes als ein Erinnerungsvermögen, das sich beliebig zwischen gewissen Erfahrungen bewegen kann.
– Lisa Halliday, „Asymmetrie“
Der Spaß am Schreiben ist es, der für mich an erster Stelle steht. Bevor meine Texte von anderen gelesen werden können, bin ich zuerst mein eigenes Publikum. Ich kann mir nicht immer aussuchen, was mich begeistert und inspiriert – vielmehr kommt da diese plötzliche Faszination in mir auf, dieses tiefe Bedürfnis, mich durch ein Thema auszudrücken, eine kurze Stimmung oder Szene festzuhalten und sie zu etwas Größerem werden zu lassen. Und obwohl ich das Geschriebene nicht wirklich selbst erlebt habe, so ist es doch, als könnte ich es über das Schreiben miterleben. Es hat etwas Magisches, tief in meiner eigenen Geschichte versinken zu können. Es ist das allerschönste Gefühl.
Und doch kommen mir ständig meine Zweifel in die Quere. Sie bringen Fragen mit wie: Ist das realistisch? Habe ich das Recht, darüber zu schreiben? Schreibe ich kompletten Bullshit? Und sie machen so lange weiter, bis meine Fantasie einer trockenen Wüste ähnelt. Statt mir die Möglichkeit zu geben, etwas zu erschaffen, begebe ich mich in den destruktiven Zustand der Schreibblockade. Ich komme in die feurige Bowser-Hölle, und Prinzessin Peach ist zehn Welten von mir entfernt. Das Schreiben macht keinen Spaß mehr.
Um nicht mein eigener Spielverderber zu sein, muss ich während des Schreibprozesses also gewissermaßen über Fehler hinwegsehen und auf mein recherchiertes Wissen vertrauen. Beim Schreiben sollte ich mich austoben dürfen, von Pilz zu Pilz hüpfen und vorerst nur die kleinen Hindernisse überwinden. Ich darf es eben einfach versuchen. Und erst wenn die Rohfassung fertig ist, kann ich es wagen, ins Bowser-Schloss einzutreten und mich dem fiesen Endboss zu stellen.
Immerhin habe ich jetzt einen Text, mit dem ich arbeiten kann. Ich habe mein Bestes gegeben und es ist noch nicht vorbei – im Laufe meines Abenteuers habe ich so viele 1UP’s angehäuft, dass ich auch den letzten Gegner noch besiegen kann. Fehler kann man korrigieren. Um den Endboss zum Schweigen zu bringen, kann ich das Manuskript von einem Experten gegenlesen lassen und mehrfach überarbeiten. Ich kann sogar alles nochmal umschmeißen, wenn ich will. Und auch wenn der Roman niemals perfekt wird, so habe ich am Ende doch eine Geschichte geschrieben. Von meinen Gedanken aufs Papier.
Es ist denn auch in den meisten Fällen so, daß man seine Themen nicht auswählen kann, wie die meisten Leser glauben, sondern die Themen wählen sich den Autor, den Schriftsteller.
– Uwe Timm
![]()
Letztendlich ist der Satz „Schreibe über das, was du kennst“ vor allem eine Frage der Interpretation. Denn was bedeutet es eigentlich, etwas zu kennen? Es bedeutet, dass ich etwas weiß, gehört oder gesehen habe. Es kann aber auch bedeuten, dass ich mich mit etwas bekannt gemacht habe, über das ich vorher noch nichts wusste.
Eine Fantasy-Autorin sollte ihre selbst erdachte Welt genauestens kennen, um davon erzählen zu können. Ein Autor von historischen Romanen sollte den historischen Kontext und die Lebensweise in vergangenen Zeiten kennen. Und eine Krimi-Autorin muss über Ermittlungsarbeit und grausame Todesursachen Bescheid wissen.
Lieber schreibe ich fehlerhaft und unperfekt über ein Thema, als dass ich überhaupt nicht schreibe. Statt mich von meiner Angst hindern zu lassen, will ich mir erlauben, so gründlich wie möglich zu recherchieren und beim Schreiben möglichst einfühlsam meiner Intuition zu folgen. Ich kann nicht mehr als mein Bestes geben. Und natürlich darf ich über etwas schreiben, das ich nicht kenne. Ich darf über alles schreiben, das mich bewegt.

Credits an das Montségur Autorenforum, in dem dieses Thema diskutiert wurde. Teile der Überlegungen habe ich in meinen Essay eingebracht.

„Schreibe nur über das, was du kennst“ – dieser Tipp schwebt mir immer wieder im Kopf herum, wenn ich blockiert vor meinem Computer sitze. Es ist einer dieser kühnen Sätze, den ich mal in einem Kurs über Kreatives Schreiben aufgeschnappt habe. Man solle sich beim Schreiben vor allem auf etwas berufen, das man selbst erlebt hat – das erleichtere nicht nur den Schreibprozess, sondern verringere auch das Risiko, etwas falsch zu machen. Verheerende Fehler lauern nämlich überall dort, wo der Autor über etwas schreibt, das er nicht kennt. Wie ein vielköpfiges Monster bäumen sie sich hinter dem Schreibenden auf und machen ihm Vorwürfe: „Dein Text ist unauthentisch, viel zu oberflächlich, ja nahezu dumm!“ Zusammen mit der Leserschaft lacht das Monster den Autor aus wie Bowser einen geschwächten Mario. Denn sie alle merken es doch, wenn der Autor nicht weiß, was er tut.
Ich möchte dem vielköpfigen, dämonisch lachenden Monster etwas entgegensetzen. In der Welt da draußen gibt es unzählige Regeln und Tipps, die uns das Schreiben erleichtern sollen, doch manchmal machen sie uns das Leben unnötig schwer. Der Gedanke, dass ich über etwas nicht schreiben darf, bloß weil ich es selbst nicht erlebt habe, blockiert mich. Weder kann ich sämtliche Gefühle und Erlebnisse dieser Welt selbst erfahren, noch ist es sinnvoll, ausschließlich autobiographisch zu schreiben. Ich finde es gerade spannend, mich über das Schreiben in andere Menschen und Lebenswelten hineinzuversetzen. Und wenn ich mir das verbieten muss, dann verbiete ich mir zugleich den Spaß am Schreiben. Hier also mein Plädoyer dafür, dass man sehr wohl über etwas schreiben darf, das man nicht kennt.
![]()
Noch bevor ich eingeschult worden bin, lernte ich, meinen Namen zu schreiben. Meistens signierte ich die ersten Wasserfarb-Kunstwerke mit „SonjA“. Es war meine erste buchstäbliche Errungenschaft, meine geschriebene Signatur. In der Grundschule formulierte ich dann kleine Texte darüber, was ich in den Sommerferien erlebt habe. Und als ich das erste Mal verknallt war, entdeckte ich das Tagebuchschreiben für mich. So oder so ähnlich kommen wohl die meisten Menschen zum Schreiben – indem sie festhalten, was sie täglich beschäftigt, wie sie die Welt wahrnehmen und was sie erleben. Kurz: indem sie beim Schreiben sich selbst begegnen.
Ich kann also nicht bestreiten, dass ich beim Schreiben in erster Linie persönliche Erlebnisse verarbeite, egal ob in Form von Tagebüchern oder fiktiven Romanen. Jedes Buch enthält einen Teil des Autors, der sich in den kleinen Dialogfetzen, aufmerksamen Beschreibungen oder großen Gefühlen verstecken kann.
Doch mein Leben dreht sich nicht nur um mich selbst. Und irgendwann wird es langweilig, mich immerzu mit meinem eigenen Leben zu beschäftigen – ich bin ja sowieso mittendrin. Es ist viel spannender, mir ein Leben auszudenken, das über die Grenzen meiner eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Als junges Mädchen bin ich meiner ersten großen Liebe auf dem Papier begegnet oder konnte mithilfe meiner Vorstellungskraft über die Baumkronen hinwegfliegen. Indem ich Geschichten schreibe, kann ich neue Welten erkunden und mich in Menschen oder Geschöpfe hineinversetzen, die vielleicht ganz anders sind als ich. Vielleicht gebe ich meinen Figuren Eigenschaften, die ich selbst gern hätte, so wie Deniz Gamze Ergüven in Mustang und Astrid Lindgren in Pippi Langstrumpf. Was immer ein Autor im Sinn hat – das Schreiben gibt ihm die Möglichkeit, etwas zu erleben, das er sonst nicht erleben könnte, egal ob es sich um Gefühle, Lebenserfahrungen oder Charaktereigenschaften handelt. Wieso sollte ich mir das verbieten?
„Nun ja“, könnte die Antwort lauten, „weil du dann Gefahr läufst, dich zu verzetteln. Vor allem wenn du über Themen schreibst, die schwer zugänglich sind – wie etwa das Leben in anderen Ländern, religiösen Gruppen oder Subkulturen – ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dir dumme Fehler passieren. Vielleicht beschreibst du das Land zu oberflächlich, weil du eben nicht die feinen Unterschiede und Hintergründe kennst. Du romantisierst die Vorstellung, die du vom Thema hast, weil du bestenfalls einen Touri-Urlaub oder eine Google-Reise unternommen hast. Im schlimmsten Fall könntest du jemanden mit deinem Text verletzen, weil du total überheblich bist oder alles ganz falsch darstellst. Und wie wird sich das wohl anfühlen, für all diese dummen Fehler dann noch ausgelacht und kritisiert zu werden?“
Und schon habe ich wieder Angst vor diesem vielköpfigen Monster, das ja gar nicht mal so falsch liegt. Natürlich fürchte ich mich davor, kritisiert und ausgelacht zu werden, andere zu verletzen oder wütend zu machen. Aber kann ich mich wirklich schon vor dem Schreiben mit all dieser Kritik auseinandersetzen? Sollte ich mir nicht erlauben, es wenigstens zu versuchen? Egal, wie umfassend ich ein Thema bearbeiten möchte: die Gefahr, einen Fehler zu machen, lauert überall. Ließe ich mich allerdings immer schon vorher von einem Vorhaben abbringen, dann würde ich niemals etwas zustande bekommen. Dann hätte ich nicht einmal gelernt, meinen Namen zu schreiben. Also plädiere ich dafür, Fehler zu machen und sie anschließend zu beheben. Wie schaffe ich es also, über etwas zu schreiben, das ich nicht kenne? Und zwar ohne in die Falle des Monsters zu tappen und mich komplett zu blockieren?
Zunächst mal kommt man um das Thema Recherche nicht herum. Alles, was über die eigenen Lebenserfahrungen hinausgeht, erfordert zwangsläufig Recherche, sogar wenn der Roman nur in einem anderen Teil von Deutschland spielt. Wenn ich über ein Thema schreiben möchte, das mir weitestgehend fremd ist, beginne ich schon vor dem Schreiben mit der Recherche.
Ich tauche so tief wie möglich in diese fremde Welt ein. Dafür verschaffe ich mir zunächst einen groben Überblick und durchsuche das gesamte Internet, denn heutzutage gibt es ja über alles genaue Informationen, man muss nur danach suchen, muss sie nur finden. Bevor ich ins Detail gehen kann, will ich zuerst das Wesentliche verstehen. Danach plane ich kleine Reisen, durch die ich besonders viele Erfahrungen zum Ort des Geschehens sammeln kann, ich sauge Informationen und Bilder in mir auf und werde selbst Teil des Themas. Allmählich kann ich mich immer besser in die Menschen einfühlen, die anders leben als ich. Wenn ich Fragen stelle, erhalte ich Antworten.
Wer wirklich recherchiert, der widmet sich voll und ganz dem Thema – und das braucht Zeit. Irgendwann verschwimmt dann alles miteinander. Nachts, wenn ich schlafe, träume ich davon. Morgens, wenn ich aufwache, spüre ich etwas, das auch mein Protagonist empfinden könnte. Es ist wie ein Puzzle, bei dem allmählich ein immer umfassenderes Bild entsteht. Und aus der anfänglichen Faszination und Romantisierung entsteht etwas realitätsnahes, neue Gefühle kommen auf, vielleicht sogar Wut auf das Thema und alle Beteiligten, Wut darauf, dass es doch nicht so leicht zugänglich ist. Vielleicht ist jeder Schreib- und Rechercheprozess wie eine Liebesbeziehung, die mit dem Kennenlernen und seinen kribbelnden, vorfreudigen Gefühlen beginnt, bis dann die ersten Hüllen fallen und man die Schattenseiten kennenlernt.
Ich glaube der Unterschied zwischen Authentizität und Oberflächlichkeit liegt in der Art und Weise, wie intensiv man sich dem Thema widmet. Eine gründliche Recherche kann sich über Jahre ziehen, weil es immer wieder neue Facetten zu entdecken gibt. Weil das Thema von der Fantasie in die Realität muss und von der Realität wieder zurück in die Fantasie und dann noch aufs Papier. Aber das ist trotz allem ein schöner, faszinierender Prozess. Und während ich das Thema vorher nicht wirklich kannte, habe ich es in dieser Zeit endlich kennen gelernt. Tatsache ist also, dass mich das Schreiben dazu bringt, etwas dazuzulernen, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Fakten, sondern auch auf der Gefühlsebene, hinein ins Menschliche, ins individuelle Erleben. Das erfordert nicht nur Empathie, sondern auch die Offenheit dafür, dass es eben doch ganz anders ist, als ich dachte.
Wer das romantisch findet, wird am schnellsten erwischt.
– Larissa Kikol
Die meisten Schriftsteller verfügen wohl über ein gewisses Maß an Empathie oder zumindest über eine Feinfühligkeit für Situationen und Augenblicke. Dadurch können sie sich – mit dem nötigen Hintergrundwissen im Kopf – gleichermaßen in einen Serienkiller wie in einen Baum hineinversetzen, ohne eines von beidem selbst zu sein. Die Kunst liegt darin, die richtigen Fragen zu stellen und der Intuition zu folgen. In Julia Camerons Schreibratgeber Von der Kunst des kreativen Schreibens heißt es: „Ich bin davon überzeugt, dass wir als Schriftsteller häufig Zugang zu Informationen haben, die sich jenseits unserer normalen Reichweite befinden. Wir fragen: ‚Wie würde sich diese Figur verhalten?‘, und die Antwort, die wir hören, basiert oft auf einem derartigen Detailreichtum und einem so hohen Niveau an Richtigkeit, dass sie der Prüfung der Zeit standhält.“
Ein tolles Beispiel für dieses Phänomen ist der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, der mit seinen raffinierten Gemälden sogar die größten Kunstexperten hinters Licht führen konnte. Für seine Fälschungen wählte Beltracchi verschollene Originale bekannter Maler oder erfand neue Motive, die sich in das Gesamtwerk eines Künstlers einreihen ließen. Dass Beltracchi jedes Bild im Geist des jeweiligen Künstlers malte und dessen künstlerische Handschrift für neue Arbeiten nutzte, zeugt neben seinen handwerklichen Fähigkeiten vor allem von einem sehr hohen Level an Empathie und Intuition. Und damit hat er in etlichen Fällen ins Schwarze getroffen.
Wenn ich mich in ein Thema einfühle, muss ich mich also nicht auf die Realität beschränken. So wie Beltracchi ein ganz neues Gemälde im Geiste des Originals erschaffen kann, darf auch ich meine Vorstellungskraft nutzen, um mich in ein Thema einzufühlen und intuitiv über etwas zu schreiben. Und mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es der Realität unerwartet nahe. Natürlich ist Authentizität wichtig, und auch Beltracchi war ein großer Kunstexperte, als er die Bilder malte. Dennoch habe ich die kreative Freiheit, meine eigene Geschichte zu erzählen. Es ist also nicht notwendig, mich auf eine genaue Wiedergabe der Realität zu beschränken – stattdessen kann ich Elemente meiner Recherche in meine eigene kreative Handlung einfließen lassen und den Schreibprozess genießen.
Ein Künstler, denke ich, ist doch nichts anderes als ein Erinnerungsvermögen, das sich beliebig zwischen gewissen Erfahrungen bewegen kann.
– Lisa Halliday, „Asymmetrie“
Der Spaß am Schreiben ist es, der für mich an erster Stelle steht. Bevor meine Texte von anderen gelesen werden können, bin ich zuerst mein eigenes Publikum. Ich kann mir nicht immer aussuchen, was mich begeistert und inspiriert – vielmehr kommt da diese plötzliche Faszination in mir auf, dieses tiefe Bedürfnis, mich durch ein Thema auszudrücken, eine kurze Stimmung oder Szene festzuhalten und sie zu etwas Größerem werden zu lassen. Und obwohl ich das Geschriebene nicht wirklich selbst erlebt habe, so ist es doch, als könnte ich es über das Schreiben miterleben. Es hat etwas Magisches, tief in meiner eigenen Geschichte versinken zu können. Es ist das allerschönste Gefühl.
Und doch kommen mir ständig meine Zweifel in die Quere. Sie bringen Fragen mit wie: Ist das realistisch? Habe ich das Recht, darüber zu schreiben? Schreibe ich kompletten Bullshit? Und sie machen so lange weiter, bis meine Fantasie einer trockenen Wüste ähnelt. Statt mir die Möglichkeit zu geben, etwas zu erschaffen, begebe ich mich in den destruktiven Zustand der Schreibblockade. Ich komme in die feurige Bowser-Hölle, und Prinzessin Peach ist zehn Welten von mir entfernt. Das Schreiben macht keinen Spaß mehr.
Um nicht mein eigener Spielverderber zu sein, muss ich während des Schreibprozesses also gewissermaßen über Fehler hinwegsehen und auf mein recherchiertes Wissen vertrauen. Beim Schreiben sollte ich mich austoben dürfen, von Pilz zu Pilz hüpfen und vorerst nur die kleinen Hindernisse überwinden. Ich darf es eben einfach versuchen. Und erst wenn die Rohfassung fertig ist, kann ich es wagen, ins Bowser-Schloss einzutreten und mich dem fiesen Endboss zu stellen.
Immerhin habe ich jetzt einen Text, mit dem ich arbeiten kann. Ich habe mein Bestes gegeben und es ist noch nicht vorbei – im Laufe meines Abenteuers habe ich so viele 1UP’s angehäuft, dass ich auch den letzten Gegner noch besiegen kann. Fehler kann man korrigieren. Um den Endboss zum Schweigen zu bringen, kann ich das Manuskript von einem Experten gegenlesen lassen und mehrfach überarbeiten. Ich kann sogar alles nochmal umschmeißen, wenn ich will. Und auch wenn der Roman niemals perfekt wird, so habe ich am Ende doch eine Geschichte geschrieben. Von meinen Gedanken aufs Papier.
Es ist denn auch in den meisten Fällen so, daß man seine Themen nicht auswählen kann, wie die meisten Leser glauben, sondern die Themen wählen sich den Autor, den Schriftsteller.
– Uwe Timm
![]()
Letztendlich ist der Satz „Schreibe über das, was du kennst“ vor allem eine Frage der Interpretation. Denn was bedeutet es eigentlich, etwas zu kennen? Es bedeutet, dass ich etwas weiß, gehört oder gesehen habe. Es kann aber auch bedeuten, dass ich mich mit etwas bekannt gemacht habe, über das ich vorher noch nichts wusste.
Eine Fantasy-Autorin sollte ihre selbst erdachte Welt genauestens kennen, um davon erzählen zu können. Ein Autor von historischen Romanen sollte den historischen Kontext und die Lebensweise in vergangenen Zeiten kennen. Und eine Krimi-Autorin muss über Ermittlungsarbeit und grausame Todesursachen Bescheid wissen.
Lieber schreibe ich fehlerhaft und unperfekt über ein Thema, als dass ich überhaupt nicht schreibe. Statt mich von meiner Angst hindern zu lassen, will ich mir erlauben, so gründlich wie möglich zu recherchieren und beim Schreiben möglichst einfühlsam meiner Intuition zu folgen. Ich kann nicht mehr als mein Bestes geben. Und natürlich darf ich über etwas schreiben, das ich nicht kenne. Ich darf über alles schreiben, das mich bewegt.

Credits an das Montségur Autorenforum, in dem dieses Thema diskutiert wurde. Teile der Überlegungen habe ich in meinen Essay eingebracht.