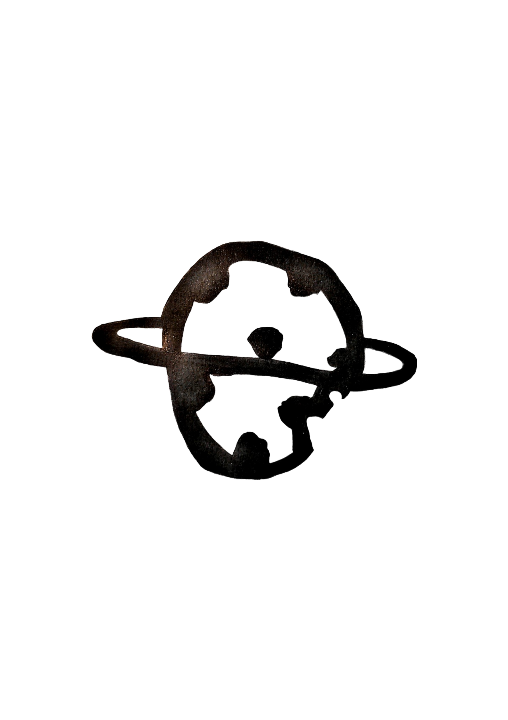Etwas zu verlieren, kann sich ganz schön bedrohlich anfühlen. Doch vielleicht ist es ja auch ein Gewinn? Hier sind meine Gedanken zum Festhalten und Loslassen.

Heute Morgen habe ich mein Handy in der Bahn vergessen. Das heißt, ich habe es in Wirklichkeit in meinem Rucksack vergessen. Dabei hatte ich es absichtlich dort verstaut: Während ich melancholisch aus dem Fenster der U-Bahn sah und das goldene Morgenlicht betrachtete, das noch nicht genug Kraft hatte, um den gefrorenen Boden aufzutauen, entschloss ich mich kurzerhand dazu, das Handy in den Rucksack zu werfen, zärtlich aber doch bestimmt. Ich hatte genug von diesem Ding und wollte eben lieber aus dem Fenster schauen. Dann zog ich meine Handschuhe wieder an, weil ich meine Hände nicht mehr zum Tippen, sondern nur zu An-mir-Dransein brauchte. Die Bahn fuhr in den Tunnel und das Sonnenlicht verschwand.
Normalerweise behalte ich das Handy stets in der Jackentasche und kontrolliere alle fünf Minuten, ob es noch da ist. Aber als ich am Hauptbahnhof aussteige, ist es plötzlich nicht mehr da. Nur das kalte Klimpern meines Schlüssels liegt vertraut in meiner Hand.
„Ich habe mein Handy in der Bahn vergessen“, denke ich, und sofort macht sich dieses unangenehme Gefühl in mir breit, dass ich etwas unwiederbringlich verloren habe. Einen Teil von mir? Ich stehe etwas verloren auf dem Gleis. Noch stehen mir die Türen offen, noch kann ich hineinspringen und mich vergewissern, ob es dort auf den Sitzen liegt. Doch da überkommt mich eine Art Urvertrauen. Ich denke: „Ist doch egal, ich will es eh nicht mehr haben.“
Die Türen der Bahnen teilen mir mit einem schrillen Signal mit, dass sie gleich schließen werden. Ich blicke erneut auf meinen ehemaligen Sitzplatz, wo nun ein Mann sitzt, der selbst konzentriert auf sein Smartphone starrt. Seines ist jedoch in eine Boomer-Hülle eingewickelt, sodass es nicht meins sein kann. Ich denke: „Jetzt ist es auch zu spät.“
Irgendwie bin ich erleichtert, aber gleichzeitig auch total aufgeregt. Natürlich bleibe ich nicht völlig ruhig, sondern krame einmal wild in meinem Rucksack herum, ohne das Ding zu finden, das scheinbar ein festes Puzzleteil meiner Seele ist. Dann laufe ich etwas unruhig die Treppen hinauf und bleibe vor dem Bäcker stehen. „Zum Glück kann ich mir auch ohne Handy was zum Essen holen“ – ja, solche absurden Gedanken denke ich. Der Mitarbeiter reicht mir meine Brezel und wünscht mir einen schönen Tag. Das erwidere ich, denke aber gleichzeitig: „Wird es ein schöner Tag, wenn ich vielleicht gerade mein Handy verloren habe?“
Da kommen plötzlich die Erleichterung und das Urvertrauen wieder. Ich denke: „Ich schreibe später allen eine E-Mail und genieße meine Freiheit. Vielleicht gehe ich trotzdem ins Fundbüro, so ein Handy hat ja leider praktische Funktionen.“
Es ist dann sowieso alles umsonst, dieses panische Gefühl, das sich über zwei lange Minuten erstreckt. Denn als ich nochmal in Ruhe schaue, ist das Handy dann doch da, im Rucksack. Ich prüfe kurz, ob es auch tatsächlich echt ist, entsperre es und scrolle über meinen Startbildschirm. Jetzt bin ich anders erleichtert.
In letzter Zeit habe ich oft diese Fantasie, mein Smartphone einfach wegzuwerfen. Zu stark sind die praktischen Funktionen mit süchtig machenden Zeiträubern verbunden. Ich könnte es mit Wucht aus dem dritten Stock schmeißen und hoffen, dass es im Schnee nicht zu weich landet. Und dann diese ständige Kommunikation. Mit einem Handy kann man tatsächlich nicht nicht kommunizieren. Vielleicht das Ding in den See werfen, mit einem glucksenden Platsch? Oder im Sandkasten verstecken? Dann kann ich endlich konzentriert schreiben, aufräumen, Hobbys haben. Dann produziere ich plötzlich meinen eigenen Real-Life-Content, statt anderen beim Leben zuzusehen. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte mein Handy in der Bahn liegen gelassen. Vielleicht wäre es besser, öfter mal jene Dinge loszulassen, von denen wir so stur behaupten, dass wir sie brauchen.
Etwas zu verlieren, kann sich ganz schön bedrohlich anfühlen. Doch vielleicht ist es ja auch ein Gewinn? Hier sind meine Gedanken zum Festhalten und Loslassen.

Heute Morgen habe ich mein Handy in der Bahn vergessen. Das heißt, ich habe es in Wirklichkeit in meinem Rucksack vergessen. Dabei hatte ich es absichtlich dort verstaut: Während ich melancholisch aus dem Fenster der U-Bahn sah und das goldene Morgenlicht betrachtete, das noch nicht genug Kraft hatte, um den gefrorenen Boden aufzutauen, entschloss ich mich kurzerhand dazu, das Handy in den Rucksack zu werfen, zärtlich aber doch bestimmt. Ich hatte genug von diesem Ding und wollte eben lieber aus dem Fenster schauen. Dann zog ich meine Handschuhe wieder an, weil ich meine Hände nicht mehr zum Tippen, sondern nur zu An-mir-Dransein brauchte. Die Bahn fuhr in den Tunnel und das Sonnenlicht verschwand.
Normalerweise behalte ich das Handy stets in der Jackentasche und kontrolliere alle fünf Minuten, ob es noch da ist. Aber als ich am Hauptbahnhof aussteige, ist es plötzlich nicht mehr da. Nur das kalte Klimpern meines Schlüssels liegt vertraut in meiner Hand.
„Ich habe mein Handy in der Bahn vergessen“, denke ich, und sofort macht sich dieses unangenehme Gefühl in mir breit, dass ich etwas unwiederbringlich verloren habe. Einen Teil von mir? Ich stehe etwas verloren auf dem Gleis. Noch stehen mir die Türen offen, noch kann ich hineinspringen und mich vergewissern, ob es dort auf den Sitzen liegt. Doch da überkommt mich eine Art Urvertrauen. Ich denke: „Ist doch egal, ich will es eh nicht mehr haben.“
Die Türen der Bahnen teilen mir mit einem schrillen Signal mit, dass sie gleich schließen werden. Ich blicke erneut auf meinen ehemaligen Sitzplatz, wo nun ein Mann sitzt, der selbst konzentriert auf sein Smartphone starrt. Seines ist jedoch in eine Boomer-Hülle eingewickelt, sodass es nicht meins sein kann. Ich denke: „Jetzt ist es auch zu spät.“
Irgendwie bin ich erleichtert, aber gleichzeitig auch total aufgeregt. Natürlich bleibe ich nicht völlig ruhig, sondern krame einmal wild in meinem Rucksack herum, ohne das Ding zu finden, das scheinbar ein festes Puzzleteil meiner Seele ist. Dann laufe ich etwas unruhig die Treppen hinauf und bleibe vor dem Bäcker stehen. „Zum Glück kann ich mir auch ohne Handy was zum Essen holen“ – ja, solche absurden Gedanken denke ich. Der Mitarbeiter reicht mir meine Brezel und wünscht mir einen schönen Tag. Das erwidere ich, denke aber gleichzeitig: „Wird es ein schöner Tag, wenn ich vielleicht gerade mein Handy verloren habe?“
Da kommen plötzlich die Erleichterung und das Urvertrauen wieder. Ich denke: „Ich schreibe später allen eine E-Mail und genieße meine Freiheit. Vielleicht gehe ich trotzdem ins Fundbüro, so ein Handy hat ja leider praktische Funktionen.“
Es ist dann sowieso alles umsonst, dieses panische Gefühl, das sich über zwei lange Minuten erstreckt. Denn als ich nochmal in Ruhe schaue, ist das Handy dann doch da, im Rucksack. Ich prüfe kurz, ob es auch tatsächlich echt ist, entsperre es und scrolle über meinen Startbildschirm. Jetzt bin ich anders erleichtert.
In letzter Zeit habe ich oft diese Fantasie, mein Smartphone einfach wegzuwerfen. Zu stark sind die praktischen Funktionen mit süchtig machenden Zeiträubern verbunden. Ich könnte es mit Wucht aus dem dritten Stock schmeißen und hoffen, dass es im Schnee nicht zu weich landet. Und dann diese ständige Kommunikation. Mit einem Handy kann man tatsächlich nicht nicht kommunizieren. Vielleicht das Ding in den See werfen, mit einem glucksenden Platsch? Oder im Sandkasten verstecken? Dann kann ich endlich konzentriert schreiben, aufräumen, Hobbys haben. Dann produziere ich plötzlich meinen eigenen Real-Life-Content, statt anderen beim Leben zuzusehen. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte mein Handy in der Bahn liegen gelassen. Vielleicht wäre es besser, öfter mal jene Dinge loszulassen, von denen wir so stur behaupten, dass wir sie brauchen.