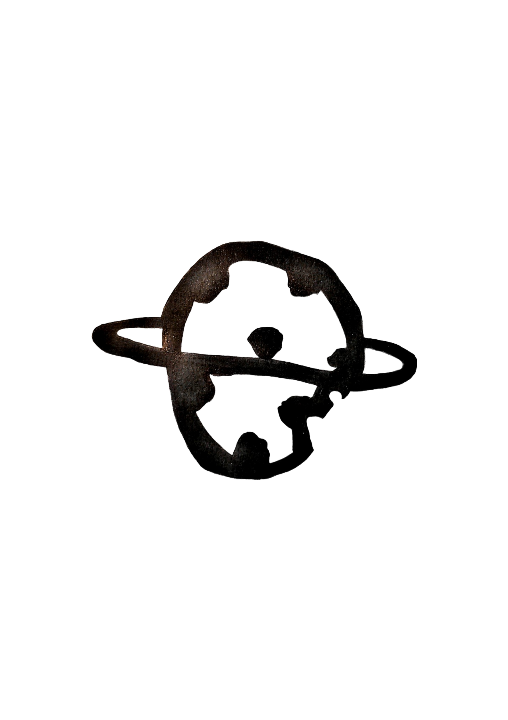Erfahrungen meines Ausflugs zum Ruhr Museum
Bei meinem heutigen Künstlertreffs erkunde ich eines meiner Lieblings-Museen in Essen: Das Ruhr Museum auf Zollverein. Mit einem Panaromadach, großflächigen Ausstellungsräumen und vielseitiger Zeit- und Kulturgeschichte sorgt dieses Museum für jede Menge ästhetische Erfahrungen – und für Heimatgefühle.

Sobald ich auf der Rolltreppe stehe, die mich zum Eingang des Ruhr Museums führt, überkommt mich ein Gefühl von Ruhe. Ich mag Rolltreppen, so ganz allgemein. In vollkommenem Gleichmut tun sie ihren Dienst und lassen sich von niemandem stressen. Im Gegenzug erwarten sie auch nichts von mir, sondern transportieren mich verlässlich nach oben, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Es ist wie eine kleine Meditation: Kurz stehenbleiben, einfach nur da sein und der Rest läuft ganz von selbst.
Wenn ich eine Rolltreppe als die allerschönste bezeichnen müsste, dann wäre es die am Ruhr Museum. Hier trete ich in einen Tunnel aus leuchtendem Orange ein. Direkt über mir tröpfelt der Regen friedlich auf die großen Glasscheiben, die den gesamten Aufstieg umranden und den Blick auf das Gelände der Zeche Zollverein freigeben.
Je weiter ich von der gleichmäßigen Bewegung der Stufen nach oben getragen werde, desto mehr kann ich von der Umgebung sehen – und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Trotz des langsamen Aufstiegs bleibt mir nicht viel Zeit, die Aussicht zu bewundern, da mich die Treppe schon wenig später in das riesige Gebäude einschleust, in dem sich das Ruhr Museum befindet.

Heute möchte ich zuerst auf das Panoramadach, das weiß ich sofort. Bevor es anfängt zu gewittern, möchte ich mit meinem Schirm im Wind stehen, die Tropfen klappern hören und die hellgraue Aussicht genießen. Ich hole mir eine Eintrittskarte und wandere die Treppen hinauf. Erst lande ich in einer kleinen Zwischenhalle, in der ich einen genaueren Blick auf die vielen Industriedenkmäler des Ruhrgebiets werfen kann, die zur Route der Industriekultur gehören – hier finde ich jede Menge Inspiration für künftige Künstlertreffs.
Der Weg zum Panoramadach führt mich schließlich auf metallenem Untergrund durch gewaltige Maschinen hindurch. Auf eine eigenartige Weise fühle ich mich in diesem Museum sehr geborgen. Durch den Hall des Gebäudes richte ich meine Aufmerksamkeit vor allem auf die Klänge, die mich umgeben. Es ist ruhig hier, doch in den Treppenhäusern begegnet man gelegentlich diesem dunklen Grollen, mal verursacht durch die Menschen, die sich hier bewegen, und mal inszeniert durch Klanginstallationen.
Auf der orangefarbenen Treppe etwa, die zu den Ausstellungsebenen führt, hört man die Maschinen der Zeche aus Lautsprechern donnern, und im Treppenhaus zum Panoramadach sind es meine eigenen Schritte auf dem Metall, die zusammen mit den Stimmen der anderen Besucher den Raum erfüllen. Es ist der Sound der Schwerindustrie.
Ich kann nicht sagen, was das für ein Gefühl ist, hier zu sein. Es ist ein bisschen so, wie an Weihnachten nach langer Zeit wieder in die Kirche zu gehen. Ich bin lange nicht mehr hier gewesen, aber der Geruch und der Hall des riesigen Gebäudes sind mir dennoch sehr vertraut. Wie ein Embryo im Bauch der Mutter: Alles da draußen scheint von einem anderen Planeten, und doch weiß ich, hier bin ich sicher. Im gigantischen Bauch der Kohlenwäsche der Zeche Zollverein.
Ich stampfe all die Stufen wieder hinunter, und dieses Mal ist das Treppenhaus erfüllt von den Stimmen einiger Leute, die sich gerade die 40 Meter hinauf zur Aussichtsplattform kämpfen. Alle sind gut gelaunt, wie meistens an diesen Orten, sie fragen mich, ob es regnet, und ob sich der Aufstieg lohnt.
Wenig später begebe ich mich wieder nach unten, über das orangefarbene Treppenhaus in die verschiedenen Ausstellungsebenen. Auf der Ebene des gegenwärtigen Ruhrgebiets (17-Meter-Ebene) sind etliche Fotografien von Bewohnern des Ruhrgebiets in ihrem natürlichen Habitat zu sehen. Insgesamt bekomme ich ein gutes Gefühl dafür, was es bedeutet, im Ruhrgebiet der Gegenwart zu leben (auch wenn die aktuellsten Bilder aus dem Jahr 2008 stammen). Die Bilder sprechen für sich und lassen eine eigene Atmosphäre entstehen, die das kollektive Lebensgefühl der hier lebenden Menschen einfangen – ganz ohne langwierige Beschreibungen.
Auch hier wirken nach einiger Zeit Geräusche auf mich ein. Sirenen, Rauschen und Krach. Ich beobachte, wie ein etwa dreizehnjähriger Junge auf kleinen weißen Feldern herumspringt, die mit Lautsprechern verbunden sind. Er scheint den Spaß an der Sache nicht zu verlieren, egal wie viel Alltagslärm die Halle erfüllt. Jeder Lautsprecher lässt ein anderes Geräusch aus dem Ruhrgebiet ertönen, und es ist ziemlich nervenaufreibend, alle gleichzeitig hören zu müssen: Da rauscht die A40 neben einer Abwasserpumpe, grunzen Bio-Schweine zusammen mit jubelnden Fans im Stadion.
Ein paar Schritte weiter gibt es außerdem eine Duft-Installation, bei der ich neben Kohle- und Asphaltgeruch auch den berüchtigten Pommesbuden-Geruch ausprobieren darf. Meiner Meinung nach hat dieses künstliche Gebräu jedoch rein gar nichts mit dem herzhaften Duft von altem Frittierfett zu tun, den ich zuletzt an der Slinky Springs Brücke gerochen habe. Aber immerhin kriege ich hier, alles zusammengenommen, ein multisensorisches Gesamtgefühl für meine Heimat.

Ich stöbere auch durch die anderen Etagen: Auf der 12-Meter-Ebene wird die vorindustrielle Entwicklung des Ruhrgebiets gezeigt und es gibt eine große Sammlung zur Archäologie, Ethnologie und Naturkunde. Dieser Teil ist sehr museumshaft und zeigt Relikte aus längst vergangenen Zeiten; Gefäße und Schwerter, ausgestopfte Tiere und uralte Bücher.
Die letzte Ausstellungshalle auf der 6-Meter-Ebene veranschaulicht, wie das Ruhrgebiet im industriellen Zeitalter ausgesehen hat. Hier sehe ich mir einen kurzen Film über das Grubenpferd Tobias an, das im Juni 1966 seine letzte Schicht unter Tage hatte. Mir war gar nicht bewusst, dass auch Tiere für lange Zeit dort unten gelebt und gearbeitet haben. Tobias – ein unkonventioneller und schöner Pferdename, wie ich finde – hatte einen eigenen Stall, bekam gutes Kraftfutter und wurde von den Bergleuten sehr geliebt.
Am Ende meines Künstlertreffs stoße ich im Museumsshop noch auf einen Bildband von Sebastian Schmitz, der alle Essener Kioske und Trinkhallen fotografisch dokumentiert hat: Trinken. Stadt. Essen. Trinkhallenkultur für Kenner und Verehrerinnen. Zu der ein- oder anderen Bude gibt es sogar einen kurzen, unterhaltsam geschriebenen Info-Text ganz nach meinem Geschmack – mit persönlichen Eindrücken und Buden-Kaffee-Verkostung. Und natürlich erkenne ich auch viele Kioske aus meiner eigenen Nachbarschaft im Buch wieder.
Inzwischen habe ich allerdings genug Eindrücke im Museum gesammelt. Das Ruhr Museum ist so riesig, dass ich mehr als einen Tag benötigen werde, um alles zu sehen. Und ich komme gerne wieder, denn für mich ist es eines der schönsten Museen, die ich bisher in Essen erkundet habe.


Sobald ich auf der Rolltreppe stehe, die mich zum Eingang des Ruhr Museums führt, überkommt mich ein Gefühl von Ruhe. Ich mag Rolltreppen, so ganz allgemein. In vollkommenem Gleichmut tun sie ihren Dienst und lassen sich von niemandem stressen. Im Gegenzug erwarten sie auch nichts von mir, sondern transportieren mich verlässlich nach oben, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Es ist wie eine kleine Meditation: Kurz stehenbleiben, einfach nur da sein und der Rest läuft ganz von selbst.
Wenn ich eine Rolltreppe als die allerschönste bezeichnen müsste, dann wäre es die am Ruhr Museum. Hier trete ich in einen Tunnel aus leuchtendem Orange ein. Direkt über mir tröpfelt der Regen friedlich auf die großen Glasscheiben, die den gesamten Aufstieg umranden und den Blick auf das Gelände der Zeche Zollverein freigeben. Je weiter ich von der gleichmäßigen Bewegung der Stufen nach oben getragen werde, desto mehr kann ich von der Umgebung sehen – und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Trotz des langsamen Aufstiegs bleibt mir nicht viel Zeit, die Aussicht zu bewundern, da mich die Treppe schon wenig später in das riesige Gebäude einschleust, in dem sich das Ruhr Museum befindet.

Sound im Ruhr Museum: das vertraute Grollen des Ruhrgebiets
Heute möchte ich zuerst auf das Panoramadach, das weiß ich sofort. Bevor es anfängt zu gewittern, möchte ich mit meinem Schirm im Wind stehen, die Tropfen klappern hören und die hellgraue Aussicht genießen. Ich hole mir eine Eintrittskarte und wandere die Treppen hinauf. Erst lande ich in einer kleinen Zwischenhalle, in der ich einen genaueren Blick auf die vielen Industriedenkmäler des Ruhrgebiets werfen kann, die zur Route der Industriekultur gehören – hier finde ich jede Menge Inspiration für künftige Künstlertreffs.
Der Weg zum Panoramadach führt mich schließlich auf metallenem Untergrund durch gewaltige Maschinen hindurch. Auf eine eigenartige Weise fühle ich mich in diesem Museum sehr geborgen. Durch den Hall des Gebäudes richte ich meine Aufmerksamkeit vor allem auf die Klänge, die mich umgeben. Es ist ruhig hier, doch in den Treppenhäusern begegnet man gelegentlich diesem dunklen Grollen, mal verursacht durch die Menschen, die sich hier bewegen, und mal inszeniert durch Klanginstallationen.
Auf der orangefarbenen Treppe etwa, die zu den Ausstellungsebenen führt, hört man die Maschinen der Zeche aus Lautsprechern donnern, und im Treppenhaus zum Panoramadach sind es meine eigenen Schritte auf dem Metall, die zusammen mit den Stimmen der anderen Besucher den Raum erfüllen. Es ist der Sound der Schwerindustrie.
Ich kann nicht sagen, was das für ein Gefühl ist, hier zu sein. Es ist ein bisschen so, wie an Weihnachten nach langer Zeit wieder in die Kirche zu gehen. Ich bin lange nicht mehr hier gewesen, aber der Geruch und der Hall des riesigen Gebäudes sind mir dennoch sehr vertraut. Wie ein Embryo im Bauch der Mutter: Alles da draußen scheint von einem anderen Planeten, und doch weiß ich, hier bin ich sicher. Im gigantischen Bauch der Kohlenwäsche der Zeche Zollverein.
Ich stampfe all die Stufen wieder hinunter, und dieses Mal ist das Treppenhaus erfüllt von den Stimmen einiger Leute, die sich gerade die 40 Meter hinauf zur Aussichtsplattform kämpfen. Alle sind gut gelaunt, wie meistens an diesen Orten, sie fragen mich, ob es regnet, und ob sich der Aufstieg lohnt.
Das Ruhrgebiet der Gegenwart
Wenig später begebe ich mich wieder nach unten, über das orangefarbene Treppenhaus in die verschiedenen Ausstellungsebenen. Auf der Ebene des gegenwärtigen Ruhrgebiets (17-Meter-Ebene) sind etliche Fotografien von Bewohnern des Ruhrgebiets in ihrem natürlichen Habitat zu sehen. Insgesamt bekomme ich ein gutes Gefühl dafür, was es bedeutet, im Ruhrgebiet der Gegenwart zu leben (auch wenn die aktuellsten Bilder aus dem Jahr 2008 stammen). Die Bilder sprechen für sich und lassen eine eigene Atmosphäre entstehen, die das kollektive Lebensgefühl der hier lebenden Menschen einfangen – ganz ohne langwierige Beschreibungen.
Auch hier wirken nach einiger Zeit Geräusche auf mich ein. Sirenen, Rauschen und Krach. Ich beobachte, wie ein etwa dreizehnjähriger Junge auf kleinen weißen Feldern herumspringt, die mit Lautsprechern verbunden sind. Er scheint den Spaß an der Sache nicht zu verlieren, egal wie viel Alltagslärm die Halle erfüllt. Jeder Lautsprecher lässt ein anderes Geräusch aus dem Ruhrgebiet ertönen, und es ist ziemlich nervenaufreibend, alle gleichzeitig hören zu müssen: Da rauscht die A40 neben einer Abwasserpumpe, grunzen Bio-Schweine zusammen mit jubelnden Fans im Stadion.
Ein paar Schritte weiter gibt es außerdem eine Duft-Installation, bei der ich neben Kohle- und Asphaltgeruch auch den berüchtigten Pommesbuden-Geruch ausprobieren darf. Meiner Meinung nach hat dieses künstliche Gebräu jedoch rein gar nichts mit dem herzhaften Duft von altem Frittierfett zu tun, den ich zuletzt an der Slinky Springs Brücke gerochen habe. Aber immerhin kriege ich hier, alles zusammengenommen, ein multisensorisches Gesamtgefühl für meine Heimat.


Der Museums Overload, das Grubenpferd Tobias und ein Trinkhallen-Buch
Ich stöbere auch durch die anderen Etagen: Auf der 12-Meter-Ebene wird die vorindustrielle Entwicklung des Ruhrgebiets gezeigt und es gibt eine große Sammlung zur Archäologie, Ethnologie und Naturkunde. Dieser Teil ist sehr museumshaft und zeigt Relikte aus längst vergangenen Zeiten; Gefäße und Schwerter, ausgestopfte Tiere und uralte Bücher.
Die letzte Ausstellungshalle auf der 6-Meter-Ebene veranschaulicht, wie das Ruhrgebiet im industriellen Zeitalter ausgesehen hat. Hier sehe ich mir einen kurzen Film über das Grubenpferd Tobias an, das im Juni 1966 seine letzte Schicht unter Tage hatte. Mir war gar nicht bewusst, dass auch Tiere für lange Zeit dort unten gelebt und gearbeitet haben. Tobias – ein unkonventioneller und schöner Pferdename, wie ich finde – hatte einen eigenen Stall, bekam gutes Kraftfutter und wurde von den Bergleuten sehr geliebt.
Am Ende meines Künstlertreffs stoße ich im Museumsshop noch auf einen Bildband von Sebastian Schmitz, der alle Essener Kioske und Trinkhallen fotografisch dokumentiert hat: Trinken. Stadt. Essen. Trinkhallenkultur für Kenner und Verehrerinnen. Zu der ein- oder anderen Bude gibt es sogar einen kurzen, unterhaltsam geschriebenen Info-Text ganz nach meinem Geschmack – mit persönlichen Eindrücken und Buden-Kaffee-Verkostung. Und natürlich erkenne ich auch viele Kioske aus meiner eigenen Nachbarschaft im Buch wieder.
Inzwischen habe ich allerdings genug Eindrücke im Museum gesammelt. Das Ruhr Museum ist so riesig, dass ich mehr als einen Tag benötigen werde, um alles zu sehen. Und ich komme gerne wieder, denn für mich ist es eines der schönsten Museen, die ich bisher in Essen erkundet habe.