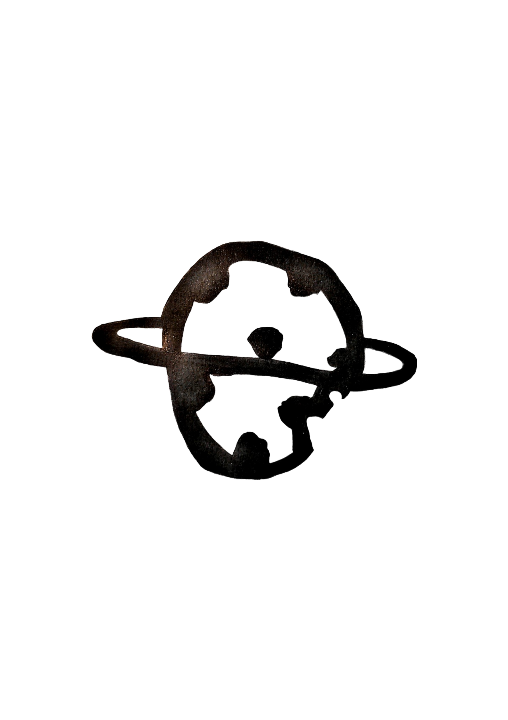Darüber, das Leben zu verändern und Schriftstellerin zu werden
Während meines Urlaubs in Lille nehme ich Abstand vom Alltag und schwanke zwischen Angst und Träumerei. Begleite mich auf meiner kreativen Reise durchs Leben.

Schon unzählige Male habe daran gedacht, nach Frankreich zu reisen. Meistens sind meine Gedanken direkt in die Provence abgeschweift, wo ich vom Mistral umweht und von alten Brunnen erfrischt werde. Dort, zwischen dem Atelier Cézanne und dem Sainte Victoire, wollte ich mich an mein altes Ich erinnern – an die mutigere Version von mir. Erst jetzt, bei einem Urlaub in Lille, fällt mir auf, dass ich ganze sechs Jahre lang nicht mehr in Frankreich gewesen bin. Und statt im Süden zu studieren, mache ich Urlaub im Norden.
Wie es sich wohl anfühlt, wieder französisch zu sprechen?
Krümelt das pain au chocolat immer noch so, wie ich es in Erinnerung habe?
Und kann ich mich noch einmal selbst finden?
All diese Fragen habe ich mir zwar nicht bewusst gestellt, als ich zusammen mit meinem Freund auf die A40 aufgefahren und drei Stunden lang geradeaus bis nach Lille gereist bin. Und doch waren sie da, irgendwo im Hinterkopf.
Als wir in unserer kleinen Ferienwohnung ankommen, die zwar klein, aber praktisch aufgeteilt ist, merke ich schnell: Die räumliche Veränderung tut mir gut. Es ist spannend, fast nervenaufreibend, weil ich noch nicht weiß, wie diese Stadt ist, in der wir jetzt anderthalb Wochen verbringen werden. Außerdem müssen wir damit klarkommen, die ganze Zeit aufeinanderhängen. Aber endlich – endlich! – muss ich mich nicht mehr mit meinen Zukunftsängsten herumschlagen. Die dürfen latent hinter einem hundertstelligen Zahlenschloss vor sich hin schweben.
Angst. Das ist das Erste, was spüre, als ich in einer französischen Boulangerie stehe und ein pain au chocolat bestellen will.
„Okay“, denke ich beschwörend, „du sagst jetzt einfach ganz entspannt bonjour, so wie du es neun Monate lang jeden Tag gemacht hast, du schaffst das, tu einfach so, als hättest du dein ganzes Leben lang nie ein anderes Wort in den Mund genommen als ein saftiges, krümeliges und schokoladiges pain au chocolat. Du hast doch hier gelebt, das wird schon nicht so schwer sein!“
Dann sage ich ganz zaghaft und leise: „Bonjour.“
„Bonjour madame!“ Das Gesicht der Verkäuferin leuchtet freundlich auf.
„Je voudrais…“ – Warte mal, sagt man das so? „Un pain au chocolat et un croissant s’il vous plaît.“ Den zweiten Teil meiner Bestellung bringe ich so schüchtern und leise hervor, dass die Verkäuferin mich nicht mehr versteht.
„Pardon?“
Ich nehme all meinen Mut zusammen und wiederhole meine Bestellung drei Stufen lauter. Daraufhin stellt sie noch so Fragen wie „Sur place?“ und „Payez-vous par carte?“ und ich antworte kurz und knapp, erleichtert darüber, dass mir alles so vertraut vorkommt.
Ich fühle mich wie eine waschechte Anfängerin, und es beschämt mich. Aber als Anfängerin kommt man wenigstens nicht drumherum, es zu versuchen. Einfach machen, wird schon schief gehen.
So fühle ich mich am Anfang unseres Urlaubs wie ein verschrecktes Schäfchen, voller Angst, nicht perfekt zu sprechen. Dabei habe ich viel schlechter gesprochen, als ich gerade ins Wohnheim zog, um neun Monate in Aix-en-Provence zu leben. Damals musste ich auch einfach drauflosreden. Es nervt – wieder ist da dieser scheiß Druck, alles perfekt zu machen. Ich habe sogar Angst, im Restaurant etwas essen zu gehen, weil ich ja was falsch machen könnte. Dabei sind wir nur drüben im Nachbarland.

Im Laufe des Urlaubs wird mir langsam klar, wie sehr ich mich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren eingeigelt habe. Ich liebe meine Einzimmerwohnung, ich liebe sie wirklich, doch je länger ich hier lebe, desto mehr verkrieche ich mich vor der Welt – aus Angst, sonst nicht mehr schreiben zu können. Alleine zu wohnen hat mich gerettet. Anfangs. Endlich hatte ich einen klaren Rückzugsort, einen Ort, der nur mir gehörte. Wo ich alles selbst bestimmen und mein Schreiben und die Kreativität zur Priorität machen konnte.
Doch vielleicht hat diese Wohnung jetzt ihre Schuldigkeit getan. Vielleicht kann sie mir heute nicht mehr das geben, was ich brauche – Freiheit und Schutz. Vielleicht belasten mich all ihre Makel, die irgendwie immer mehr werden: Die schimmlige Ecke in der Küche, die eigenartigen Nachbarn, das gleißende Licht vom Südbalkon. Die Stockflecken, die Enge, das winzige Bücherregal. Der alte Kühlschrank ohne Lampe, der Staub vom Vormieter, die zappelnden Silberfische. Meine Wohnung engt mich ein. Ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr denken.
Ich halte an etwas fest, das mir längst nicht mehr guttut, das mich gefangen hält, statt mir die Freiheit zu geben, die ich brauche. Warum? Aus Angst. Aus Angst davor, dass sich etwas verändert. Aus Angst, mich selbst zu verlieren. Aber diese Warteschleife, ist die denn besser? Kann ich mich beim Warten finden?
Die Protagonisten in meinen Geschichten warten oft. Ich kann sie kennenlernen, indem ich sie warten lasse. Aber irgendwann ist es genug mit Warten, irgendwann wird es zu viel. Wenn man den Protagonisten kennt, muss die Handlung weitergehen. Wenn ich darauf warte, dass sich etwas verändert, dann zieht mein Leben an mir vorbei, ohne dass ich ein Teil davon bin. Schreiben funktioniert nicht ohne Leben.
Dreihundert Kilometer weit entfernt von Zuhause fällt mir plötzlich wieder ein, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte. Denn ich komme ins Träumen. Ich träume davon, in der Boulangerie zu arbeiten, in der ich gerade das krümelige Blätterteiggebäck esse und Cappuccino trinke und die jungen Französinnen bei der Arbeit beobachte. Ich träume davon, Gebäck in Tüten zu packen, wieder fließend französisch zu sprechen und meine Zeit mit Schreiben zu verbringen. An meinem Roman zu schreiben, an meinem Blog.
Kann ich das nicht auch in Deutschland?
Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich viel cooler ist, in Frankreich zu leben (und das definitiv eins meiner Ziele ist) – Ja, warum eigentlich nicht? Hier in Deutschland denke ich die ganze Zeit, dass ich was anderes machen müsste, hart arbeiten, gestresst sein, mir einen „richtigen“ Job suchen. Was immer das bedeutet.
Da ist eine gehässige Stimme in mir, die Stimme des Teufelchens, die mir ja doch immer wieder sagt, dass „Schriftstellerin werden“ kein echter Plan sei. Aber diese Stimme sagt nicht die Wahrheit. Sagt sie nicht. Die Stimme ist nur dumm, und verletzt, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Es ist eine Stimme, die nicht mir gehört. Seit anderthalb Jahren zieht sie mich runter und sorgt dafür, dass ich in Woche 12 hängenbleibe.
Es ist ein Paradoxon der Reise zur Kreativität, dass wir ernsthaft daran arbeiten müssen, uns nicht zu ernst zu nehmen. Wir müssen spielen lernen. Die Kreativität muss aus den Grenzen der Kunst befreit werden […].
Ich nehme mich selbst zu ernst, habe ein zu großes Ego. „Beim Bäcker arbeiten? Aber wozu habe ich denn studiert?“ Ich will die Kontrolle behalten, will etwas machen, dass den Erfolg garantiert, statt ihn infrage zu stellen. Aber die Kontrolle ist grau und eng. Sie lässt keinen Platz für kreatives Erkunden. Also verliere ich meinen Lebenswillen und meine Kreativität.
Mein Vorsatz für das nächste halbe Jahr ist also folgender: Ernsthaft daran zu arbeiten, mich nicht zu ernst zu nehmen. Mir zu erlauben, das Leben zu genießen, eben weil ich schreibe.

Zugegeben, in diesem Artikel ging es weniger um die Stadt Lille, als vielmehr um alles, was der Urlaub in mir ausgelöst hat. Wenn du mich also in die schöne Stadt im Norden Frankreichs begleiten willst, dann folge mir hier zu Teil 2.

Schon unzählige Male habe daran gedacht, nach Frankreich zu reisen. Meistens sind meine Gedanken direkt in die Provence abgeschweift, wo ich vom Mistral umweht und von alten Brunnen erfrischt werde. Dort, zwischen dem Atelier Cézanne und dem Sainte Victoire, wollte ich mich an mein altes Ich erinnern – an die mutigere Version von mir. Erst jetzt, bei einem Urlaub in Lille, fällt mir auf, dass ich ganze sechs Jahre lang nicht mehr in Frankreich gewesen bin. Und statt im Süden zu studieren, mache ich Urlaub im Norden.
Wie es sich wohl anfühlt, wieder französisch zu sprechen?
Krümelt das pain au chocolat immer noch so, wie ich es in Erinnerung habe?
Und kann ich mich noch einmal selbst finden?
All diese Fragen habe ich mir zwar nicht bewusst gestellt, als ich zusammen mit meinem Freund auf die A40 aufgefahren und drei Stunden lang geradeaus bis nach Lille gereist bin. Und doch waren sie da, irgendwo im Hinterkopf.
Als wir in unserer kleinen Ferienwohnung ankommen, die zwar klein, aber praktisch aufgeteilt ist, merke ich schnell: Die räumliche Veränderung tut mir gut. Es ist spannend, fast nervenaufreibend, weil ich noch nicht weiß, wie diese Stadt ist, in der wir jetzt anderthalb Wochen verbringen werden. Außerdem müssen wir damit klarkommen, die ganze Zeit aufeinanderhängen. Aber endlich – endlich! – muss ich mich nicht mehr mit meinen Zukunftsängsten herumschlagen. Die dürfen latent hinter einem hundertstelligen Zahlenschloss vor sich hin schweben.
Die Angst und das Pain au chocolat
Angst. Das ist das Erste, was spüre, als ich in einer französischen Boulangerie stehe und ein pain au chocolat bestellen will.
„Okay“, denke ich beschwörend, „du sagst jetzt einfach ganz entspannt bonjour, so wie du es neun Monate lang jeden Tag gemacht hast, du schaffst das, tu einfach so, als hättest du dein ganzes Leben lang nie ein anderes Wort in den Mund genommen als ein saftiges, krümeliges und schokoladiges pain au chocolat. Du hast doch hier gelebt, das wird schon nicht so schwer sein!“
Dann sage ich ganz zaghaft und leise: „Bonjour.“
„Bonjour madame!“ Das Gesicht der Verkäuferin leuchtet freundlich auf.
„Je voudrais…“ – Warte mal, sagt man das so? „Un pain au chocolat et un croissant s’il vous plaît.“ Den zweiten Teil meiner Bestellung bringe ich so schüchtern und leise hervor, dass die Verkäuferin mich nicht mehr versteht.
„Pardon?“
Ich nehme all meinen Mut zusammen und wiederhole meine Bestellung drei Stufen lauter. Daraufhin stellt sie noch so Fragen wie „Sur place?“ und „Payez-vous par carte?“ und ich antworte kurz und knapp, erleichtert darüber, dass mir alles so vertraut vorkommt.
Ich fühle mich wie eine waschechte Anfängerin, und es beschämt mich. Aber als Anfängerin kommt man wenigstens nicht drumherum, es zu versuchen. Einfach machen, wird schon schief gehen.
So fühle ich mich am Anfang unseres Urlaubs wie ein verschrecktes Schäfchen, voller Angst, nicht perfekt zu sprechen. Dabei habe ich viel schlechter gesprochen, als ich gerade ins Wohnheim zog, um neun Monate in Aix-en-Provence zu leben. Damals musste ich auch einfach drauflosreden. Es nervt – wieder ist da dieser scheiß Druck, alles perfekt zu machen. Ich habe sogar Angst, im Restaurant etwas essen zu gehen, weil ich ja was falsch machen könnte. Dabei sind wir nur drüben im Nachbarland.

Ausbruch aus der Enge: sein Leben verändern
Im Laufe des Urlaubs wird mir langsam klar, wie sehr ich mich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren eingeigelt habe. Ich liebe meine Einzimmerwohnung, ich liebe sie wirklich, doch je länger ich hier lebe, desto mehr verkrieche ich mich vor der Welt – aus Angst, sonst nicht mehr schreiben zu können. Alleine zu wohnen hat mich gerettet. Anfangs. Endlich hatte ich einen klaren Rückzugsort, einen Ort, der nur mir gehörte. Wo ich alles selbst bestimmen und mein Schreiben und die Kreativität zur Priorität machen konnte.
Doch vielleicht hat diese Wohnung jetzt ihre Schuldigkeit getan. Vielleicht kann sie mir heute nicht mehr das geben, was ich brauche – Freiheit und Schutz. Vielleicht belasten mich all ihre Makel, die irgendwie immer mehr werden: Die schimmlige Ecke in der Küche, die eigenartigen Nachbarn, das gleißende Licht vom Südbalkon. Die Stockflecken, die Enge, das winzige Bücherregal. Der alte Kühlschrank ohne Lampe, der Staub vom Vormieter, die zappelnden Silberfische. Meine Wohnung engt mich ein. Ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr denken.
Ich halte an etwas fest, das mir längst nicht mehr guttut, das mich gefangen hält, statt mir die Freiheit zu geben, die ich brauche. Warum? Aus Angst. Aus Angst davor, dass sich etwas verändert. Aus Angst, mich selbst zu verlieren. Aber diese Warteschleife, ist die denn besser? Kann ich mich beim Warten finden?
Die Protagonisten in meinen Geschichten warten oft. Ich kann sie kennenlernen, indem ich sie warten lasse. Aber irgendwann ist es genug mit Warten, irgendwann wird es zu viel. Wenn man den Protagonisten kennt, muss die Handlung weitergehen. Wenn ich darauf warte, dass sich etwas verändert, dann zieht mein Leben an mir vorbei, ohne dass ich ein Teil davon bin. Schreiben funktioniert nicht ohne Leben.
Schriftsteller werden: kein echter Plan
Dreihundert Kilometer weit entfernt von Zuhause fällt mir plötzlich wieder ein, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte. Denn ich komme ins Träumen. Ich träume davon, in der Boulangerie zu arbeiten, in der ich gerade das krümelige Blätterteiggebäck esse und Cappuccino trinke und die jungen Französinnen bei der Arbeit beobachte. Ich träume davon, Gebäck in Tüten zu packen, wieder fließend französisch zu sprechen und meine Zeit mit Schreiben zu verbringen. An meinem Roman zu schreiben, an meinem Blog.
Kann ich das nicht auch in Deutschland?
Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich viel cooler ist, in Frankreich zu leben (und das definitiv eins meiner Ziele ist) – Ja, warum eigentlich nicht? Hier in Deutschland denke ich die ganze Zeit, dass ich was anderes machen müsste, hart arbeiten, gestresst sein, mir einen „richtigen“ Job suchen. Was immer das bedeutet.
Da ist eine gehässige Stimme in mir, die Stimme des Teufelchens, die mir ja doch immer wieder sagt, dass „Schriftstellerin werden“ kein echter Plan sei. Aber diese Stimme sagt nicht die Wahrheit. Sagt sie nicht. Die Stimme ist nur dumm, und verletzt, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Es ist eine Stimme, die nicht mir gehört. Seit anderthalb Jahren zieht sie mich runter und sorgt dafür, dass ich in Woche 12 hängenbleibe.
„Es ist ein Paradoxon der Reise zur Kreativität, dass wir ernsthaft daran arbeiten müssen, uns nicht zu ernst zu nehmen. Wir müssen spielen lernen. Die Kreativität muss aus den Grenzen der Kunst befreit werden […].“ – Julia Cameron
Ich nehme mich selbst zu ernst, habe ein zu großes Ego. „Beim Bäcker arbeiten? Aber wozu habe ich denn studiert?“ Ich will die Kontrolle behalten, will etwas machen, dass den Erfolg garantiert, statt ihn infrage zu stellen. Aber die Kontrolle ist grau und eng. Sie lässt keinen Platz für kreatives Erkunden. Also verliere ich meinen Lebenswillen und meine Kreativität.
Mein Vorsatz für das nächste halbe Jahr ist also folgender: Ernsthaft daran zu arbeiten, mich nicht zu ernst zu nehmen. Mir zu erlauben, das Leben zu genießen, eben weil ich schreibe.

Zugegeben, in diesem Artikel ging es weniger um die Stadt Lille, als vielmehr um alles, was der Urlaub in mir ausgelöst hat. Wenn du mich also in die schöne Stadt im Norden Frankreichs begleiten willst, dann folge mir hier zu Teil 2.